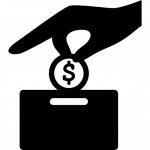Während des „Sommers der Migration“ in 2015 erlebte Deutschland innerhalb nur weniger Monate eine ungewohnt hohe Zuwanderung. Mehr als eine Million Geflüchtete kamen zwischen 2015 und 2016 in Deutschland an, viele kamen aus Kriegsgebieten, aus Syrien, Afghanistan und Irak. Dieser Zustrom stellte die Länder und insbesondere Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen.
In Deutschland zeigten damals viele Menschen eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, hießen Geflüchtete willkommen, spendeten Kleidung und Spielzeug, fuhren selbst an die Grenzen, um zu helfen. Der prägendste Satz dieser Zeit stammt von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Wir schaffen das!“
Ohne Ehrenamtliche wäre es nie zu schaffen gewesen, sie handelten (und handeln) schnell, unbürokratisch und selbstorganisiert. Viele von ihnen engagierten sich erstmals, andere kamen aus bestehenden Strukturen wie antirassistischen oder kirchlich-karitativen Gruppen. Schnell wurde ein Wort für diesen enormen Einsatz gefunden: Die Willkommenskultur!
Wie hat sich die Willkommenskultur in Köln entwickelt?
Köln hat dabei eine besondere Qualität entwickelt wie Gabi Klein, Kölner Freiwilligen Agentur, beschreibt: „In vielen Veedeln organisierten sich engagierte Bürer:innen, bevor überhaupt die Schutzsuchenden angekommen waren. WiSü-Willkommen im Sürth war die erste Initiative, sie entstand schon Ende 2013. So stark war der Wunsch, ein Willkommen auszudrücken.“ so Gabi Klein, „Oft waren rein humanitären Motive ausschlaggebend. Wenn die Tagesthemen Bilder von fliehenden Menschen in Seenot zeigte, schrieben Menschen nachts noch eine Mail „Was kann ich tuen? Ich kann nicht nach Italien fahren, um zu helfen, aber hier möchte ich aktiv werden.‘ Andere wollten Position gegen Rassismus und Ausgrenzung zeigen. Eine Riehlerin rief bei uns an und sagte fassungslos, dass eine Lichterkette gegen eine Unterkunft geplant sei. ‚In meinem Riehl, das kann doch nicht sein!‘ Auch hier organisierten sich Nachbar:innen zu einer großen „Willkommensdemonstration“ und die nächste Initiative war geboren.“
So entstanden ab 2013 viele Willkommensinitiativen in ganz Köln. In den Hochphasen gab es geschätzt 80 Initiativen oder Zusammenschlüsse von Menschen, die ganz pragmatisch Geflüchtete unterstützen wollten. Ebenso wichtig war und ist vielen, an einer offenen und vielfältigen Gesellschaft mitzuwirken, die alle unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus willkommen heißt.
„In den Initiativen und Vereinen, die teilweise aus ihnen entstanden, wurde und wird Demokratie im Alltag gelebt. Man setzte sich auseinander über die gemeinsamen Werte, Möglichkeiten und Grenzen. Bis spät in die Nacht wurde darüber diskutiert, wer wir entscheiden darf, wie man Partizipation und Mitsprache für alle ermöglicht und zeitgleich handlungsfähig bleibt; welche Petition angestoßen wird und wo der gemeinsame Einsatz durch unterschiedliche politische Positionen endet.“ beschreibt Gabi Klein die Selbstorganisation.
Neben den ehr lokal in den Veedeln agierenden Initiativen gründeten sich auch kölnweit vertretene Gruppen, die sich themenspezifisch einsetzen oder, wie der AK Politik der Willkommensinitiativen, den Initiativen eine Stimme geben wollte. Auch auf hauptamtlicher Ebene hat sich ein breites und stabiles Netzwerk gebildet, dass eng vernetzt mit der Kölner Stadtverwaltung, der Politik und lokalen Bündnissen agiert.
Was waren Bewährungsproben?
„Wie stark das Willkommensnetzwerk in Köln ist, hat sich nach dem Überfall auf die Ukraine gezeigt. Am nächsten Tag schon stand die erste Initiativen am Hauptbahnhof und bot geflohenen Ukrainer:innen Essen, Getränke und Weitervermittlung an. Sehr schnell schlossen sich die Willkommensinitiativen, die Vereine und die Stadtverwaltung zusammen und schauten, was wo benötigt wurde und wer diese Ressourcen an Material, Zeit oder Kompetenzen am besten einbringen kann. Das hocheffiziente Zusammenwirken dieser verschiedenen Akteur:innen basierte auf der jahrelangen Zusammenarbeit, nur so konnte schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll diese große Herausforderung gemeistert werden.“ beschreibt Gabi Klein das Netzwerk.
Andere Herausforderungen sind die sich so stark veränderten politischen Entwicklungen. „Immer stärker wird Flucht unter dem Begriff Migration und dann sehr schnell als irreguläre Migration, als Problem, dargestellt. Dies macht sich tagtäglich bemerkbar: Rassismus auf der Straße, Anfeindungen gegen Engagierte, Infragestellung der Legitimität von gemeinnützigen Vereinen oder schwer verständliches Verwaltungsagieren belasten nicht nur Geflüchtete, sondern auch Engagierte,“ so Klein, „Ich habe schon öfter die Frage gehört: ‚Wofür mache ich das eigentlich? Warum sitze ich nicht einfach mit meinen Enkelkindern im Garten und bin zufrieden?‘“
Was schafft Mut zum Weitermachen?
„Das wäre eine sehr gute Frage an die Engagierten!“ antwortet Gabi Klein, „Sie wissen am besten, was sie weitermachen oder auch anfangen lässt. Nach wie vor starten sehr viele Menschen ein Engagement in der Willkommenskultur. Wenn wir die Gründe fragen, sind es die gleichen wie vor zehn Jahren: Menschen in Not unterstützen, über den eigenen Tellerrand schauen, Position gegen Ausgrenzung zeigen und, das darf man nicht vergessen, Menschen mit ähnlichem Mindset kennen lernen und einfach Spaß haben“
Was wünscht ihr euch?
„Ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass wir unser Zusammenleben nur mit – oder dank – Migration schaffen. Migration ist die Basis unserer Gesellschaft und daher sollte sie gewünscht, geschützt, gestärkt werden.“ So Gabi Klein, „Und natürlich muss sie gefördert werden! Das Zusammenleben von Alt- und Neukölner:innen gelingt nicht von alleine, es braucht Engagement und das sollte die besten Bedingungen vorfinden. Dafür sorgen wir in unserem bewährten Netzwerk gerne weiterhin.“